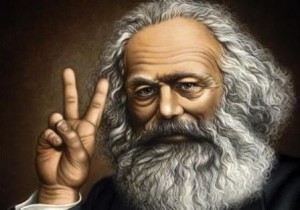Seit etwas mehr als ein Jahr sitzt Denis de la Reussille als einziger Vertreter der Partei der Arbeit im Nationalrat. Die Machtverhältnisse im Nationalrat erschweren seine Arbeit beträchtlich, wie der Genosse im Interview erklärt.
Denis, du bist jetzt über ein Jahr im Nationalrat? Wie hast du dich eingelebt?
Gut, auch weil ich in der Fraktion der Grünen Partei bin. Dies war ein kohärenter Entscheid, da wir auf kantonaler Ebene in Neuenburg bereits in der gemeinsamen Parlamentsfraktion PopVertSol (PdA, Grüne, SolidaritéS) zusammenarbeiten. Einer Fraktion beizutreten, war ein notwendiger Schritt, um in einer Kommission Einsitz zu haben. Ich hätte die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen bevorzugt, aber die Aussenpolitische Kommission passt mir auch bestens und ich hab mich da gut eingearbeitet.
Du hast seit deiner Wahl noch keinen Vorstoss eingereicht. Warum nicht?
Ja, das stimmt. Ich habe mich auf die laufenden Geschäfte konzentriert, wie etwa jenes über die Reform der AHV. Diesbezüglich habe ich auch mit einem Redebeitrag die AHVplus-Initiative unterstützt. Für die kommende Session habe ich nun einige Interpellationen vorbereitet. Es gibt im Parlament ein richtiges Gerangel bezüglich den Interventionen. Grund dafür ist die Medienpräsenz und weil die Medien die ParlamentarierInnen anhand ihrer Anzahl Reden klassifizieren. Und dies führt zu einer Flut von Interventionen, von denen einige wirklich komisch und unnötig sind. Auf dieses Interventionengerangel bin ich sehr allergisch.
Einige Medien haben dich mit Josef Zisyadis verglichen, der ja bekanntlich der letzte PdA-Vertreter vor dir im Nationalrat war. Sie beschreiben dich als viel diskreter…
In der Tat, ich bin ja nicht Josef Zisyadis. Ich respektiere und schätze seine Arbeit, aber ich habe nicht den gleichen Charakter wie er. Da ich jahrelang in der Exekutive in Le Locle gearbeitet habe, bin ich vielleicht eher gewohnt, Kompromisse zu suchen. Ich bin kein Anhänger von Schlagzeilen.
Hast du den Eindruck, dass du Einfluss auf die Debatten nehmen kannst? Oder zumindest die radikale, linke Stimme besser hörbar machst, so wie du es dir vor deiner Wahl vorgenommen hast?
Die Tatsache, dass ich der einzige Vertreter der radikalen Linken bin, hat ein gewisses Interesse in den Medien ausgelöst, nicht zuletzt in der Deutschschweiz. Ich versuche konsequent, meine Ideen durchzusetzen. Aber auf der parlamentarischen Ebene müssen wir uns keine grossen Illusionen über meine Möglichkeiten machen, dass ich grossen Einfluss auf die Debatten nehmen könnte. Dies vor allem nach den letzten Wahlen, bei denen sich das Kräfteverhältnis klar nach rechts ins bürgerliche Lager verschoben hat. Eine Anekdote zeigt diese Realität gut auf: Während der Debatte um die Unternehmenssteuerreform III haben die Bürgerlichen eine Reihe von zusätzlichen Regelungen eingeführt im Vergleich zum Vorschlag des Bundesrats. Als Frau Martullo-Blocher von der SVP einen eigenen Vorstoss verteidigte, wurde sie von einem SP-Abgeordneten gefragt, inwiefern ihr Vorschlag ihre eigene Firma bevorteilen würde. Frau Martullo-Blocher hat unverfroren zugeben, dass die AktionärInnen zwischen 25 und 30 Millionen Franken mehr bekommen würden. Das hat mich doch überrascht. Ich hatte eine Antwort erwartet wie: «Das ist für das Wohl des Landes» oder «davon profitieren wir alle» etc. Aber es scheint so, dass die Bürgerlichen überhaupt keine Hemmungen mehr haben und so Scheinargumentationen gar nicht mehr nötig sind. Diese Tatsache gibt eine kleine Vorstellung darüber, wie die Atmosphäre in Sachen Kräfteverhältnisse im Parlament ist.
Es ist also schwierig, Einfluss zu nehmen?
Ich kann über die Fraktion der Grünen einen gewissen Einfluss nehmen, ebenso durch meine Arbeit in der Aussenpolitischen Kommission. Dies im Wissen, dass die Mehrzahl der Entscheidungen in den Kommissionen fällt. Folgendes ist auch noch zu erwähnen: Während im Kanton Neuenburg die PdA von der SP oft kritisiert wird, vertritt die SP im Nationalrat linkere Positionen als die kantonale Partei. In Sachfragen stimmen wir oft gleich ab. Trotzdem: Die Situation in unserem politischen Lager ist kompliziert. Das spüre ich sehr stark, vor allem weil ich aus dem Neuenburger Berggebiet komme, das heisst aus einer Region, die klar links ist. Für mich ist es eine Art Minderheits-Kur!
In welchen Dossiers hast du dich besonders stark engagiert und welche werden es in Zukunft sein?
In der laufenden AHV-Reform werde ich alles daran setzen, die Positionen der PdA einzubringen. Die Bürgerlichen sind mit einem Kraftakt daran, die 2. Säule, die Pensionskassen, zu stärken anstatt die AHV. Die AHV ist aber das viel gerechtere und solidarischere Rentensystem. Ich hab mich auch gegen die Kürzungen der Gelder für die Entwicklungshilfe eingesetzt sowie in weiteren Dossiers, welche die Aussenpolitische Kommission betreffen. Ich musste feststellen, dass es nicht möglich ist, sich in allzu viele laufende Geschäfte einzuarbeiten. Die Anzahl an Dokumentationen, die wir für ein Geschäft erhalten, ist wirklich enorm!
Nach deiner Wahl hast du angekündigt, die Rolle der Lobbys anzuprangern. Was hast du diesbezüglich gemacht?
Die kürzlich gewählten Präsidenten des Nationalrats sowie des Ständerats werden beide von der Krankenkasse Groupe Mutuel entlohnt. Dies, um nur eines von vielen möglichen Beispielen zu nennen. Sobald ich die Möglichkeit habe, werde ich in dieser Sache handeln. Ich beabsichtige daher eine entsprechende Interpellation einzureichen. Wir müssen uns aber auch bewusst sein, dass ähnliche Vorstösse schon vor meiner Zeit im Parlament eingereicht wurden. Diesbezüglich erfinde ich das Rad nicht neu. Und bei den aktuellen Kräfteverhältnisse haben solche Vorstösse keine Chance. Aber trotzdem: Wenn die Presse darüber berichtet, ist auch schon einiges erreicht.
Die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative der SVP war eine wichtige Debatte im Nationalrat. Sind die diesbezüglichen Beschlüsse für dich zufriedenstellend?
Ich gehöre nicht zur Gruppe jener Personen, die begeistert von der Personenfreizügigkeit sind. In Grenzregionen wie Neuenburg und dem Tessin gibt es ein echtes Problem mit Dumpinglöhnen. Da können und dürfen wir nicht einfach wegschauen. Aber es sind sicher nicht die Vorschläge der SVP, die das Problem lösen. Es braucht eine verstärkte Kontrolle der Arbeitsbedingungen, auch wenn es dafür schwierig ist, die Mittel zu bekommen. Hinzu kommt, dass es in vielen Branchen keine Gesamtarbeitsverträge gibt, die für einen besseren Schutz der ArbeiterInnen sorgen als das Gesetz.
Du hast dich für den Bundesbeschluss über die Schaffung eines Fonds für die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr (Naf) ausgesprochen. Deine Partei hat die Stimmfreigabe beschlossen und ein Teil der Linke ruft zum Nein auf. Haben die Interessen deines Kantons Vorrang?
Als ich der Fraktion der Grünen beitrat, habe ich angekündigt, dass ich diese Vorlage unterstützen werde. Die kantonalen Realitäten sind ein gewichtiger Grund für diesen Entscheid. Ich möchte daran erinnern, dass zum Beispiel in Le Locle der ganze Verkehr, somit auch der Grenzverkehr, durch das Zentrum führt. Ich habe kein Auto, ich benütze den öffentlichen Verkehr. Aber es braucht eine Lösung, damit der Verkehr nicht durch die Zentren der Ortschaften führt. Und dies wird mit dem Naf möglich und es ermöglicht auch die Umsetzung von Projekten in der Agglomeration. Jedoch kann ich das Nein von Links zum Naf verstehen und nachvollziehen.
Aus dem vorwärts vom 3. Februar 2017 Unterstütze uns mit einem Abo.
 dab. MediCuba Schweiz feiert dieses Jahr sein 25-jähriges Bestehen und MediCuba Europa sein 20-jähriges. In Havanna findet am 6. Mai der Auftakt zu den Jubiläumsfeierlichkeiten statt.
dab. MediCuba Schweiz feiert dieses Jahr sein 25-jähriges Bestehen und MediCuba Europa sein 20-jähriges. In Havanna findet am 6. Mai der Auftakt zu den Jubiläumsfeierlichkeiten statt.