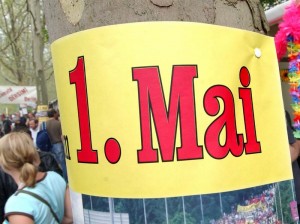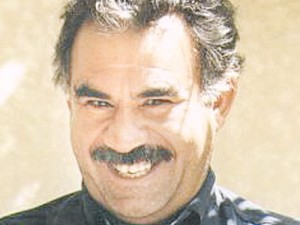Mitte März 2013 lancierte der Verein «?Hausarbeit aufwerten – Sans-Papiers regularisieren?» die Kampagne «?Keine -Hausarbeiterin ist illegal?». Gefordert werden mehr Rechte für die rund 40?000 Hausangestellten, die ohne – Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz leben und arbeiten.
Mitte März 2013 lancierte der Verein «?Hausarbeit aufwerten – Sans-Papiers regularisieren?» die Kampagne «?Keine -Hausarbeiterin ist illegal?». Gefordert werden mehr Rechte für die rund 40?000 Hausangestellten, die ohne – Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz leben und arbeiten.
Seit einigen Jahren wird die Problematik der Care-Arbeit – also Tätigkeiten wie putzen, bügeln, kochen, Kinder hüten, Kranke und Alte betreuen – in Wissenschaft und Politik breit diskutiert. Einigkeit herrscht über drei grundlegende Tatsachen: Erstens ist seit Anfang der 90er Jahre der Hauswirtschaftssektor massiv gewachsen, so auch in der Schweiz. Zweitens ist der Care-Bereich traditionell Frauensache, wobei Migrantinnen – mit und ohne Aufenthaltsbewilligung – eine grosse Mehrheit der externalisierten Hausarbeit übernehmen. Drittens gehört der Care-Bereich zum prekarisierten Arbeitsmarktsegment. Genau an diesen drei Punkten knüpft die Kampagne an.
Ein boomender Sektor
Bei der Lancierung der Kampagne wurde eine Petition an den Bundesrat vorgestellt. Salvatore Pittà, Kampagnen-Koordinator, erklärt auf Anfrage des vorwärts die Gründe für diese Petition: «Wir erhoffen uns vom Bundesrat, dass er die Bedeutung der Hausarbeit anerkennt und Lösungen umsetzt, um den dort Arbeitstätigen ohne geregelten Aufenthaltsstatus menschenwürdige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu ermöglichen.» Tatsächlich arbeiten in der Schweiz mehr als 40?000 ArbeiterInnen ohne geregelten Aufenthalt – sogenannte Sans-Papiers – in einem Privathaushalt. 90 Prozent dieser HausarbeiterInnen sind Frauen.
Wie in der Petition hervorgehoben, sind die Arbeitsbedingungen im Bereich Privathaushalt besonders prekär: ungeregelte Arbeitszeiten, niedrige Löhne, soziale Isolation, grosse Abhängigkeit von den Arbeitgebenden und Fehlen von sozialem Schutz. Nun wurde die im Rahmen des Freizügigkeitsabkommens mit der Europäischen Union (EU) bestehende Möglichkeit, in denjenigen Sektoren und Branchen sogenannte Normalarbeitsverträge (NAV) zu etablieren, in denen wiederkehrend Lohn- und Sozial-dump-ing festgestellt wird, von den Gewerkschaften genutzt, um den Bereich der Privathaushalte zu regulieren. Im Juli 2004 wurde im Kanton Genf ein NAV mit verbindlichen Mindestlöhnen für Hausangestellte durchgesetzt. Fünf Jahre später wurde ein NAV auf schweizweiter Ebene unterzeichnet. Zur Kontrolle der Arbeitsbedingungen werden tripartite Kommissionen des Bundes (TPK) eingesetzt, wobei auch der Aufenthaltsstatus der ArbeiterInnen überprüft wird. Dies führt zur widersprüchlichen Situation, dass bei der Kontrolle der Arbeitsbedingungen Sans-Papiers aufgrund ihrer fehlenden Aufenthaltsbewilligung ausgeschafft werden können. Wie positioniert sich die Kampagne «Keine Hausarbeiterin ist illegal» dazu? Pittà erklärt: «Wir unterstützen die engagierten Gewerkschaften bei den Neuverhandlungen und wollen somit eine bedeutende Verbesserung des NAV erreichen, sowohl bezüglich Wirkungsbereich wie auch bezüglich Mindestlohn. Die Kontrolle des NAV befürworten wir bezüglich der Durchsetzung der vereinbarten Arbeitsbedingungen, nicht aber bezüglich der Überprüfung des Aufenthaltsstatus‘.»
Die Falle des «?linken Utilitarismus?»
Die Kampagne muss als Bestandteil einer breiteren Bewegung verstanden werden, die für ein Bleiberecht für alle einsteht. Nicht alle in diesem Bereich tätigen Organisationen haben den Appell der Kampagne jedoch unterzeichnet. «Die Organisationen, die sich gegen einen Beitritt entschieden haben, gaben nachvollziehbare Gründe dafür an, die wir respektieren. In der Zusammenarbeit mit ihnen möchten wir auf bestehende Gemeinsamkeiten bauen. Wir sind erst am Anfang unserer Kampagne und zuversichtlich, dass dies gelingen kann. Eine innere Zerfleischung lehnen wir ab», so Pittà.
Wie sooft bei Kampagnen, die auf einer breiten Koalition von Organisationen mit unterschiedlichen Interessen basieren, besteht auch bei «Keine Hausarbeiterin ist illegal» die Gefahr, in die Falle des «linken Utilitarismus» zu tappen. So soll laut Petition an den Bundesrat die Verbesserung der juristischen Situation sowie der Arbeitssituation von Sans-Papiers darum erfolgen, weil «die Hausarbeiterinnen ohne geregelten Aufenthalt in bedeutender Weise dazu beitragen, dass der Wohlstand und die Lebensqualität unzähliger Menschen in der Schweiz zunehmen». Hier wird also argumentativ die utilitaristische Logik weitergeführt, wonach Sans-Papiers Rechte erhalten sollen, weil sie funktional sind für die hiesige Wirtschaft und Gesellschaft. In der Petition fehlt jeglicher Hinweis darauf, dass die Regularisierung der Sans-Papiers im Kontext einer weltweiten Bewegungsfreiheit zu verorten ist, durch die allen Menschen – unabhängig von ihrer Herkunft – die gleichen Rechte zugestanden werden sollen.
Tanzen oder Boxen?
Ist diese Perspektive einer Nachlässigkeit der InitiatorInnen geschuldet oder ist sie vielmehr in der Kampagne selbst angelegt? Die Kampagne erinnert stark an das, was sich im gewerkschaftlichen Vokabular als «Organizing» durchgesetzt hat. Es geht um den Versuch einer Kombination von Selbstorganisation der Betroffenen und «politischer Neupositionierung» bestehender Sans-Papiers Strukturen. Darauf weist auch die Liste der Organisationen hin, die hinter dem Verein stehen, nämlich in erster Linie Gewerkschaften und Sans-Papiers Anlaufstellen. So unterstreicht Pittà, dass die Selbstorganisation der direkt Betroffenen ein besonderes Anliegen der Kampagne ist: «In erster Linie sind wir daran, diese Strukturen zu stärken, wo sie vorhanden sind, oder dort aufzubauen, wo sie noch nicht existieren. Das gelingt uns sehr gut. Wir können bereits beobachten, dass sich Hausarbeitende ohne geregelten Aufenthaltsstatus zunehmend auch auf überregionaler Ebene einbringen. Mit unserer Argumentation und Bündnispolitik unterstützen wir darüber hinaus bewusst weiter gehende Bestrebungen, die schon seit Jahren dafür kämpfen, dass ein tiefer gehendes Umdenken in der Gesellschaft stattfinden kann.»
Organizing-Politik weist nun aber stets einen ambivalenten Charakter auf: Wie kann der Spagat zwischen Selbstorganisation und sozialpartnerschaftlicher Bündnispolitik gelingen? Oder, um in Bildern zu sprechen: Ist es möglich, mit PolitikerInnen, dem Bundesrat und den Arbeitgebenden «zu tanzen» und gleichzeitig gegen sie «zu boxen»? Zentral für die Beantwortung dieser Frage ist die Form der Aneignung des sozialen und politischen Terrains durch die Sans-Papiers selbst, die auf der Grundlage der (noch) marginalen und verstreuten Konflikte ihre Rechte einfordern.
WEITERE INFORMATIONEN ZUR KAMPAGNE UND ZUR PETITION: WWW.KHII.CH
 Die Partei der Arbeit Zürich (PdAZ) nimmt ohne Überraschung den heutigen (28. April) Entscheid des Zürcher Kantonsrats zur Kenntnis, die Initiative «Steuerbonus für dich» für ungültig zu erklären. Die PdAZ wird gegen Entscheid des Kantonsrats Einsprache erheben und vor Bundesgericht gehen.
Die Partei der Arbeit Zürich (PdAZ) nimmt ohne Überraschung den heutigen (28. April) Entscheid des Zürcher Kantonsrats zur Kenntnis, die Initiative «Steuerbonus für dich» für ungültig zu erklären. Die PdAZ wird gegen Entscheid des Kantonsrats Einsprache erheben und vor Bundesgericht gehen.