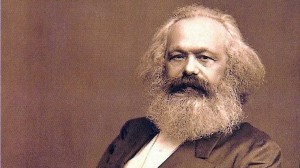«Ich sehe keine andere Möglichkeit, als diese Reform durchzusetzen. Vielleicht auch tatsächlich damit zu leben, dass wir vorübergehend Mindereinnahmen haben. Dies im Wissen aber, dass wir in fünf, zehn Jahren ein System haben, das nicht dauernd angefochten wird», so Finanzministerin Eveline Widmer Schlumpf bei der Vorstellung der Unternehmenssteuerreform III (USR III) am 22. September 2014. Diese «Mindereinahmen», wie es die Bundesrätin nennt, belaufen sich auf mindestens 2,2 Milliarden Franken und sind nichts anderes als Steuergeschenke an die grossen international tätigen Unternehmen im Lande.
«Ich sehe keine andere Möglichkeit, als diese Reform durchzusetzen. Vielleicht auch tatsächlich damit zu leben, dass wir vorübergehend Mindereinnahmen haben. Dies im Wissen aber, dass wir in fünf, zehn Jahren ein System haben, das nicht dauernd angefochten wird», so Finanzministerin Eveline Widmer Schlumpf bei der Vorstellung der Unternehmenssteuerreform III (USR III) am 22. September 2014. Diese «Mindereinahmen», wie es die Bundesrätin nennt, belaufen sich auf mindestens 2,2 Milliarden Franken und sind nichts anderes als Steuergeschenke an die grossen international tätigen Unternehmen im Lande.
Die Steueroase Helvetia
Laut Bundesamt für Statistik zählt die Schweiz 572’000 Unternehmen. Rund 24?000 international tätige Unternehmen profitieren von kantonalen Steuerbegünstigungen. Es sind dies die so genannten Statusgesellschaften (Holding-, Domizil- und gemischte Gesellschaften). Sie bilden gerade mal vier Prozent aller Unternehmen. Doch – und hier beginnt das Eisen heiss zu werden – spült diese Minderheit der Unternehmen knapp vier Milliarden Franken in die Bundeskasse, was beinahe 50 Prozent der gesamten Gewinnsteuereinnahmen ausmacht. 17 Prozent dieser Einnahmen verbleiben bei den Kantonen. Hinzu zahlen die Statusgesellschaften über eine Milliarde Franken Kantons- und Gemeindesteuern. Milliardenbeträge, die deutlich machen, über welche gigantische finanzielle und somit auch politische Macht diese Unternehmen verfügen.
Nun soll aber Schluss sein mit der steuerpolitischen Wohlfühloase Helvetia. Dies will die EU und zwar mit kräftiger Unterstützung der OEZD und der G20. In den Erläuterungen des Bundesrats ist zu lesen: «Die steuerliche Ungleichbehandlung von in- und ausländischen Einnahmen ist für die EU eine unerlaubte staatliche Unterstützung und bildet somit eine Verletzung des Freihandelsabkommens aus dem Jahr 1972 zwischen der Schweiz und der EU.» In anderen Worten: Die Schweiz verschafft sich durch ihre aktuelle Steuerpolitik Vorteile im internationalen Steuerwettbewerb, indem sie gegen EU-Regelungen verstösst. So fordert Brüssel von Bern immer vehementer Massnahmen hin zu einer EU-kompatiblen Besteuerung der Unternehmen und vor allem die Abschaffung der Statusgesellschaften.
Im Sinne und Geist des adligen Herrn Tancredi
So stand der Bundesrat vor folgender Frage: Wie kann die EU besänftigt werden, ohne die eidgenössischen Steuerprivilegien für international tätige Unternehmen abzuschaffen? Denn ohne Steuervorteile drohen diese mit dem Wegzug ins Ausland und mit ihnen auch die Steuereinnahmen von jährlich vier Milliarden. Die Antwort: Die kantonalen Statusgesellschaften werden – so wie von der EU verlangt – abgeschafft, doch dafür wird eine Reihe von neuen Steuerprivilegien eingeführt. So einfach. Ein Vorhaben, das an den berühmten Satz aus dem Film «Der Leopard» (Il Gattopardo) von Luchino Visconti aus dem Jahr 1963 erinnert: «Wenn wir wollen, dass alles bleibt wie es ist, dann ist es nötig, dass alles sich verändert.» Dies sagte der adlige Herr Tancredi zum Fürsten Selina, als auch auf Sizilien der Sieg der Republikaner unaufhaltsam wurde. Im Sinne, Geist und Zweck des adligen Herrn Tancredi ist die USR III konzipiert. economiesuisse, der Dachverband der Wirtschaft, fasst die Ziele der Reform wie folgt zusammen: «Die Stärkung der steuerlichen Wett-bewerbsfähigkeit des Standorts, die Sicherstellung der internationalen Akzeptanz des Steuersystems sowie der Erhalt der finanziellen Ergiebigkeit der Unternehmenssteuern.» Klar ist für economiesuisse, dass «eine erfolgreiche Unternehmenssteuerreform alle drei Ziele erreichen» muss. Ziele, die in der Praxis ein Steuergeschenk von 2,2 Milliarden Franken für die gut 24’000 betroffenen Grossunternehmen ergeben.
Die Kernelemente der Reform
Konkret schlägt der Bundesrat die so genannten Lizenzboxen vor, ein Modell ähnlich wie es England, Belgien und Luxemburg schon kennen. Lizenzboxen sind Steuererleichterungen für Unternehmen, die mit Patenten Geld machen. Das sind hauptsächlich Firmen, die Forschung betreiben, und sicher davon profitieren würden die Pharmakonzerne. Kein Zufall angesichts der starken Lobby der Pharmaindustrie im Bundeshaus. Die Box würde dazu führen, dass ein Chemiekonzern in Basel-Stadt mit vielen Lizenzen weniger Steuern zahlen muss als ein Rohstoffunternehmen im Kanton Genf oder ein Dienstleistungsunternehmen im Kanton Zürich. Doch die Schweizer Verfassung sieht vor, dass die Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit erfolgen muss. Wird dieses Verfassungsprinzip mit der Lizenzbox verletzt? «Das ist tatsächlich ein sehr heikler Punkt», erklärt SFR-Bundeshauskorrespondent Philipp Burkhardt in der Sendung «Echo der Zeit» vom 21. Juni 2014. So lese man «brisantes in den schriftlichen Unterlagen des Bunderates». Denn die Regierung hält wörtlich selber fest, dass «eine Lizenzbox verfassungsrechtlich problematisch sei (…), jedoch aus Standortsicht notwendig». Burkhardt kommt zu folgendem Fazit: «Der Bundesrat verstösst wissentlich gegen die Verfassung, nimmt den Verstoss aber in Kauf, weil es aus seiner Sicht nicht anders geht.»
Neben den Boxen sind die Einführung des «kalkulatorischen Zinsabzugs auf das Sicherheitskapital» sowie die Senkung der kantonalen Gewinnsteuersätze die Kernelemente der Reform. Bei ersterem profitieren die Firmen mit einem hohen Eigenkapital und der Bund geht davon aus, dass alleine diese Massnahme zu Steuerausfällen, sprich Steuergeschenken, von rund 630 Millionen Franken führen wird. Bei der Senkung der kantonalen Gewinnsteuer wird geschätzt, dass sie von heute durchschnittlich 22 auf 16 Prozent fallen wird. Mehrere Kantone, darunter Genf und Waadt, haben Schritte in diese Richtung bereits angekündigt. Das Geschenkpaket an die Unternehmen beinhaltet dann noch weitere «Massnahmen zur Verbesserung der Systematik des Steuerrechts» (economiesuisse) wie etwa die Abschaffung der Emissionsabgabe, die Anpassung der Kapitalsteuer und die «unbeschränkte zeitliche Nutzung von Verlustvorträgen mit jährlicher Beschränkung auf 80 Prozent des steuerbaren Ergebnisses».
Gegenfinanzierung durch Sozialabbau
Stellt sich die Frage der Gegenfinanzierung der 2,2 Milliarden, die sich Bund und Kantone je zur Hälfte teilen wollen. Als Zuckerwürfel für die parlamentarische Linke will der Bundesrat die Kapitalgewinnsteuer einführen, die etwa 300 Millionen in die Kasse bringen würde. Eine alte linke Forderung, die aber im Jahr 2001 bereits vom Volk mit über 65 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt wurde. Den Rest will der Bund mit erhofften Mehreinnahmen finanzieren. Dazu die Bundesrätin Widmer-Schlumpf: «Wir sehen heute, dass die Einnahmen höher sein werden als die Ausgaben im Jahre 2016 und wenn man sich jetzt politisch vernünftig oder sachdienlich einstellt, dann könnte man das für eine Gegenfinanzierung gebrauchen.» Schön zu wissen, dass wir eine Bundesrätin haben, die in die Zukunft sehen kann. Hingegen weniger schön ist die Tatsache, dass Widmer-Schlumpf in diesem Zusammenhang verschweigt, dass mit den möglichen Überschüssen bereits andere Vorhaben finanziert werden sollen. So zum Beispiel die 300 zusätzlichen Millionen für die Armee oder die Reform der Ehepaarbesteuerung, die ein Loch von gut einer Milliarde Franken reissen wird. Der blauäugigen Zukunftswunschvorstellung der Bundesrätin ist die harte Realität der letzten Jahre gegenüberzustellen. Die Steuergeschenke durch die letzte Reform aus dem 2008 in der Höhe von sieben Milliarden Franken wurden mit einem massiven Sozialabbau finanziert, wie etwa durch die «Reformen» der Arbeitslosen- und der Invalidenversicherung, sowie durch den Abbau im Bildungswesen und im öffentlichen Dienst. Mit der USR III wird es nicht anders sein. Wetten? Die laufende Reform der AHV lässt grüssen …
Aus der Printausgabe vom 16. Januar 2015. Unterstütze uns mit einem Abo.
 Die zuständige Kommission des Ständerats lehnt die «AHVplus» Initiative des Gewerkschaftsbundes ab. Wie immer, wenn es um die AHV geht, wird der klare Verfassungsauftrag missachtet. Ein Verfassungsauftrag, der nur mit einem radikalen Wechsel erfüllt werden kann. «Die sozialpolitische Kommission des Ständerats nimmt die Sorgen vieler Rentnerinnen und Rentner nicht ernst und lehnt eine dringend nötige Rentenerhöhung, so wie sie die Initiative «AHVplus» vorschlägt, sang- und klanglos ab», schreibt der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) in seiner Medienmitteilung von 26. März 2015. Selbst 116 Franken im Monat mehr für RentnerInnen mit einer Minimalrente von monatlich 1160 Franken sind der Kommission zu viel. Bei einer Maximalrente von derzeit 2320 Franken wären es 232 Franken und bei einer vollen Ehepaarrente würde der Zuschlag 348 Franken betragen. Die «AHVplus»-Initiative des SGB verlangt eine Erhöhung von zehn Prozent der aktuellen AHV-Renten und wurde am 17. Dezember 2013 mit über 112000 Unterschriften eingereicht.
Die zuständige Kommission des Ständerats lehnt die «AHVplus» Initiative des Gewerkschaftsbundes ab. Wie immer, wenn es um die AHV geht, wird der klare Verfassungsauftrag missachtet. Ein Verfassungsauftrag, der nur mit einem radikalen Wechsel erfüllt werden kann. «Die sozialpolitische Kommission des Ständerats nimmt die Sorgen vieler Rentnerinnen und Rentner nicht ernst und lehnt eine dringend nötige Rentenerhöhung, so wie sie die Initiative «AHVplus» vorschlägt, sang- und klanglos ab», schreibt der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) in seiner Medienmitteilung von 26. März 2015. Selbst 116 Franken im Monat mehr für RentnerInnen mit einer Minimalrente von monatlich 1160 Franken sind der Kommission zu viel. Bei einer Maximalrente von derzeit 2320 Franken wären es 232 Franken und bei einer vollen Ehepaarrente würde der Zuschlag 348 Franken betragen. Die «AHVplus»-Initiative des SGB verlangt eine Erhöhung von zehn Prozent der aktuellen AHV-Renten und wurde am 17. Dezember 2013 mit über 112000 Unterschriften eingereicht.