 Die Perspektive bleibt die Beseitigung der kapitalistischen Ordnung und die Errichtung eines sozialistischen Gesellschaftssystems. Seit langem waren wir nicht mehr so motiviert, an einer 1. Mai-Demo teilzunehmen, wie in diesem Jahr.
Die Perspektive bleibt die Beseitigung der kapitalistischen Ordnung und die Errichtung eines sozialistischen Gesellschaftssystems. Seit langem waren wir nicht mehr so motiviert, an einer 1. Mai-Demo teilzunehmen, wie in diesem Jahr.
Heute geht es nicht nur um kürzere Arbeitszeiten oder mehr Ferien. Beides schenken uns die gnädigen Herren in Form von Kurzarbeit und Entlassungen. Es geht auch nicht um Mitbestimmung oder höhere Löhne. Wir haben in der Vergangenheit schon bis zum Überdruss erlebt, dass uns solches nur zugestanden wird, wenn es die Macht und den Profit der Kapitalisten nicht schmälert. Keines dieser Zugeständnisse hat uns einer Lösung der gesellschaftlichen Probleme nähergebracht.
Der Kapitalismus wird die Krise überstehen
Die Krise, die auch unser Land voll getroffen hat, ist nicht nur eine Finanz- und Spekulationskrise, nicht nur die Krise der Banken, der Börsen, der Industrie oder der Pensionskassen. Es ist die Krise des kapitalistischen Systems schlechthin mit allen ihren verheerenden Folgen wie massenhafte Vernichtung von Produktivkräften, Produktionsrückgang, steil ansteigende Arbeitslosigkeit usw. Es ist die Krise eines korrupten Systems, das auf Ausbeutung und rücksichtslosem Profitstreben beruht, das die Umwelt gefährdet und unsere Lebensgrundlagen bedroht. Doch die Lasten der Krise tragen nicht die Spitzen der Banken und Konzerne, die sich weiterhin mit Boni bereichern, sondern die wenig verdienenden Lohnabhängigen.
Es wäre falsch, wenn wir uns Illusionen hingeben würden. Der Kapitalismus wird auch diese Krise überstehen, zwar geschwächt und gedemütigt, aber er wird noch einmal davonkommen. Dafür sorgt nicht zuletzt der Staat, der in einer solchen Lage seine wahre Natur als Instrument der herrschenden Klasse enthüllt. Er greift mit seiner ganzen ökonomischen und politischen Macht in die Wirtschaft ein, um das System zu retten.
So wurden zum Beispiel Milliardenbeträge in die UBS hineingepumpt, um die marode Bank zu «stabilisieren», das heisst, um sie vor dem Konkurs zu bewahren und den Finanzplatz Schweiz zu retten. Diese Milliarden sind Teile unseres Arbeitseinkommens, die wir als Steuern dem Staat abgeliefert haben. Somit tragen die Steuerzahler die Verluste des Finanzdebakels. Es wird vorgegeben, diese Massnahme liege im Interesse der ganzen Bevölkerung, doch sie konnte nicht verhindern, dass die Bank jetzt Tausende ihrer Angestellten in die Wüste schickt. Wurden wir gefragt, ob wir mit diesem «Rettungspaket» einverstanden seien? Mit solchen staatlichen Eingriffen werden wir indirekt dazu gezwungen, das Profitsystem zu stützen – ein wunderbares Beispiel unserer vielgepriesenen «Volksherrschaft»!
Dasselbe gilt für die staatlichen Investitionsprogramme, die der Bundesrat verfügt. Auch hier werden Milliarden von Steuergeldern in den Sand der kapitalistischen Wirtschaft gesetzt, ohne dass die StaatsbürgerInnen etwas dazu sagen können.
«Ein Kommunist muss träumen können»
Die Ereignisse der letzten Monate haben wieder einmal deutlich gemacht, dass wir in einer Klassengesellschaft leben. Sie bestätigen, was Marx und Engels schon vor 161 Jahren im «Manifest der Kommunistischen Partei» geschrieben haben. Sein erster Satz lautet: «Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaften ist die Geschichte von Klassenkämpfen». Dieser Satz gilt ohne Einschränkung auch für die Gegenwart, wobei klar ist, dass sich in jeder Epoche neue Probleme stellen, die nach neuen Lösungen verlangen. Die Krise hat gezeigt, dass die demokratischen Rechte, die wir heute besitzen, nicht genügen und dass wir ständig versuchen müssen, sie zu erweitern und zu festigen. In unserer politischen Arbeit kämpfen wir dafür, den Einfluss der kapitalistischen Kreise auf Politik und Ökonomie, auf Massenmedien und Kultur zurückzudrängen und aus der Welt zu schaffen. Unsere Perspektive aber bleibt die Beseitigung der kapitalistischen Ordnung und die Errichtung eines sozialistischen Gesellschaftssystems. Dieses Ziel bestimmt unseren täglichen Kampf.
Leider müssen wir feststellen, dass wir heute weiter vom Ziel entfernt sind als auch schon. Es genügt deshalb nicht, untätig zuzuschauen, wie der Kapitalismus langsam zerbröckelt. Lenin hat den lapidaren Satz geprägt: «Ein Kommunist muss träumen können». Der Satz verpflichtet, nicht nur aktiven Widerstand gegen die Missstände unserer Zeit zu leisten, sondern unsere Vision einer sozialistischen Gesellschaft in die Wirklichkeit umzusetzen. Die Krise hat bewiesen, dass das System, in dem wir leben, überwunden werden muss.
Die Herausforderung annehmen
Der 1. Mai ist untrennbar mit der sozialistischen Bewegung in der ganzen Welt verknüpft. Als internationaler Feier- und Kampftag macht er uns bewusst, dass wir in unserem Kampf nicht allein sind, sondern dass uns unzählige Verbündete zur Seite stehen. Seine Themen und Forderungen haben sich im Laufe der Zeit gewandelt. Waren es früher der Kampf gegen den Faschismus, gegen die imperialistischen Kriege oder gegen die Atomrüstung, die im Mittelpunkt standen, so ist es heute, wie übrigens schon in den dreissiger Jahren des letzten Jahrhunderts, die Krise des Kapitalismus. Wir sind gewillt, die Herausforderung anzunehmen, und verstehen den 1. Mai 2009 als Symbol unserer Entschlossenheit, das Ziel eines Systemwechsels kompromisslos anzustreben. Dieses Bewusstsein wird uns an der diesjährigen Maifeier begleiten.



 Jugendliche dürfen in Dänikon (ZH) auch weiterhin nach 22 Uhr aus dem Haus. Das Zürcher Verwaltungsgericht hiess eine Beschwerde der JUSO Kanton Zürich und der Einwohnerin Regula Lächler gut.
Jugendliche dürfen in Dänikon (ZH) auch weiterhin nach 22 Uhr aus dem Haus. Das Zürcher Verwaltungsgericht hiess eine Beschwerde der JUSO Kanton Zürich und der Einwohnerin Regula Lächler gut. Am 3. Mai, dem Internationalen Tag der Medienfreiheit, fordert die Mediengewerkschaft comedia zusammen mit der Internationalen Föderation der Journalistinnen und Journalisten IFJ eine bessere Verankerung der Medienfreiheit weltweit und in der Schweiz.
Am 3. Mai, dem Internationalen Tag der Medienfreiheit, fordert die Mediengewerkschaft comedia zusammen mit der Internationalen Föderation der Journalistinnen und Journalisten IFJ eine bessere Verankerung der Medienfreiheit weltweit und in der Schweiz. Die Perspektive bleibt die Beseitigung der kapitalistischen Ordnung und die Errichtung eines sozialistischen Gesellschaftssystems. Seit langem waren wir nicht mehr so motiviert, an einer 1. Mai-Demo teilzunehmen, wie in diesem Jahr.
Die Perspektive bleibt die Beseitigung der kapitalistischen Ordnung und die Errichtung eines sozialistischen Gesellschaftssystems. Seit langem waren wir nicht mehr so motiviert, an einer 1. Mai-Demo teilzunehmen, wie in diesem Jahr. Die drei Organisation kritisieren die schweizerische Aussenpolitik, die sich einerseits stark für die Menschenrechte einsetzt, aber andererseits im Freihandelsabkommen mit Kolumbien die systematischen Menschenrechtsverletzungen mit keinem Wort erwähnt. Eine vorschnelle Ratifizierung des Abkommens würde dem Ruf der Schweiz als Vertreterin der Menschenrechte enorm schaden. Somit hätte die Schweiz zwei Sachen zu verlieren: ihre Vertrauenswürdigkeit im Engagement für die Menschenrechte und ihren internationalen Ruf.
Die drei Organisation kritisieren die schweizerische Aussenpolitik, die sich einerseits stark für die Menschenrechte einsetzt, aber andererseits im Freihandelsabkommen mit Kolumbien die systematischen Menschenrechtsverletzungen mit keinem Wort erwähnt. Eine vorschnelle Ratifizierung des Abkommens würde dem Ruf der Schweiz als Vertreterin der Menschenrechte enorm schaden. Somit hätte die Schweiz zwei Sachen zu verlieren: ihre Vertrauenswürdigkeit im Engagement für die Menschenrechte und ihren internationalen Ruf. Die Euro-Pride 09 findet vom 2. Mai bis zum 7. Juni in Zürich statt. Die fundamentalistische EDU diskriminiert auf untolerierbare Weise den Anlass und alle Homosexeulle. Die Reaktion der PdA Zürich.
Die Euro-Pride 09 findet vom 2. Mai bis zum 7. Juni in Zürich statt. Die fundamentalistische EDU diskriminiert auf untolerierbare Weise den Anlass und alle Homosexeulle. Die Reaktion der PdA Zürich.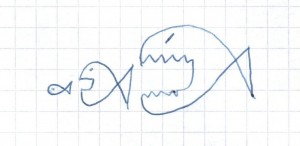 Das Gipfeltreffen der «Bolivarischen Alternative für die Völker Unseres Amerika» (ALBA) ist gestern im venezolanischen Cumaná zu Ende gegangen. Die gemeinsame Erklärung lässt keinen Zweifel offen…
Das Gipfeltreffen der «Bolivarischen Alternative für die Völker Unseres Amerika» (ALBA) ist gestern im venezolanischen Cumaná zu Ende gegangen. Die gemeinsame Erklärung lässt keinen Zweifel offen… Falls sich die Schweiz entschliessen würde, den Saab Gripen zu erwerben, würde sich Saab verpflichten, im Gegenzug Trainingsflugzeuge des Typs PC-21 für rund eine Milliarde Franken zu kaufen. Die Medienmitteilung der GsoA.
Falls sich die Schweiz entschliessen würde, den Saab Gripen zu erwerben, würde sich Saab verpflichten, im Gegenzug Trainingsflugzeuge des Typs PC-21 für rund eine Milliarde Franken zu kaufen. Die Medienmitteilung der GsoA.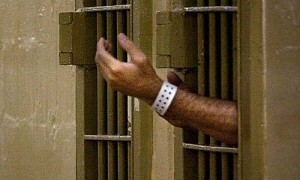 Zeigen wir John unsere Solidarität und gehen wir gemeinsam zur Gerichtsverhandlung! Dienstag 14. April ’09 um 12:00 Uhr, Flüchtlingscafé (Infoladen Kasama, Militärstrasse 87a, Zürich. Die Gerichtsverhandlung wird um 13:30 Uhr beim Bezirksgericht Zürich stattfinden.
Zeigen wir John unsere Solidarität und gehen wir gemeinsam zur Gerichtsverhandlung! Dienstag 14. April ’09 um 12:00 Uhr, Flüchtlingscafé (Infoladen Kasama, Militärstrasse 87a, Zürich. Die Gerichtsverhandlung wird um 13:30 Uhr beim Bezirksgericht Zürich stattfinden. Seit 12. Dezember 2008 setzt die Schweiz das sogenannte Dublin-II-Abkommen um. Wie das Bundesamt für Migration (BFM) am 7. April mitteilte, wurde ab Beginn der Umsetzung bis Ende März 997 Personen für eine Abschiebung vorgesehen und davon bereits 140 Asylsuchende ausgeschafft. Bei 424 Personen steht eine Rückschiebung kurz bevor.
Seit 12. Dezember 2008 setzt die Schweiz das sogenannte Dublin-II-Abkommen um. Wie das Bundesamt für Migration (BFM) am 7. April mitteilte, wurde ab Beginn der Umsetzung bis Ende März 997 Personen für eine Abschiebung vorgesehen und davon bereits 140 Asylsuchende ausgeschafft. Bei 424 Personen steht eine Rückschiebung kurz bevor.