Die UBS kämpft – nicht gegen Risiken, sondern gegen Regeln
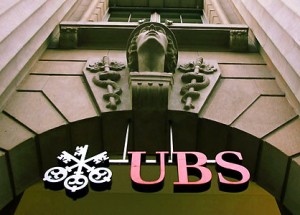 dom. Die Schweizer Finanzbehörden wollen die neu geschaffene Megabank UBS stärker regulieren. Diese reagiert mit einer beispiellosen Lobbying-Offensive. Über der emotional geführten Debatte geht beinahe vergessen: mit Regulierungen lassen sich keine Bankencrashs verhindern.
dom. Die Schweizer Finanzbehörden wollen die neu geschaffene Megabank UBS stärker regulieren. Diese reagiert mit einer beispiellosen Lobbying-Offensive. Über der emotional geführten Debatte geht beinahe vergessen: mit Regulierungen lassen sich keine Bankencrashs verhindern.
Auch in diesem Jahr hatte das Salär von UBS-Chef Sergio Ermotti Entrüstung ausgelöst: 15 Millionen Franken Jahreslohn, das sorgte selbst bei FDP-Präsident Thierry Burkart für Kopfschütteln: Eine solche Entschädigung sei «aus Sicht der Bevölkerung viel zu hoch», Masshalten sei angesagt.
Druck auf UBS wächst
Das findet auch der Ständerat: Mitte März hatte er überraschend einer Motion zugestimmt, die Bankier-Löhne bei 5 Millionen Franken deckeln will. Der Entscheid fiel zeitgleich mit der Veröffentlichung des parlamentarischen Untersuchungsberichts zum Fall der Credit Suisse. Dass diese über Jahre hinweg hohe Risiken einging, regulatorische Auflagen missachtete und trotz massiver Verluste hohe Prämien an das Management ausbezahlte, dürfte die Annahme der Motion begünstigt haben. Entschieden ist aber noch nichts, die Motion muss erst noch durch den Nationalrat. Ermotti plagen derweil ohnehin andere Sorgen: Seine Megabank soll stärker reguliert werden – und das vor dem Hintergrund einer schwachen Performance an der Börse. Die UBS hat von der letztjährigen Rallye der europäischen Bankaktien nicht profitieren können, ihre Aktie hat in den letzten zwölf Monaten gar an Wert verloren.
Nach der staatlich orchestrierten Übernahme der Credit Suisse, bei der die UBS einen buchhalterischen Gewinn in Höhe von 29 Milliarden Dollar einfahren konnte, befinde sich die neu geschaffene Mega-Bank «in einem Rückzugsgefecht», schrieb die Financial Times am vergangenen Wochenende. Andreas Venditti, Bankanalyst bei Vontobel, meint dazu: Was die UBS kontrollieren könne, laufe gut: «die Integration, der Abbau von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten, die Restrukturierung» – dass der Aktienkurs gegenüber seinen Konkurrenten an Boden verliere, sei die Folge von «Regulierungsunsicherheit».
UBS zieht alle Register
Verantwortlich dafür sind unter anderem der Bundesrat und die Finanzmarktaufsicht. Die Finanzbehörden sehen sich nach dem Kollaps der Credit Suisse mit wachsendem Zweifel an der Resilienz der Schweizer Finanzregulierung konfrontiert – jetzt will man Stärke demonstrieren. Künftig soll die UBS ihre ausländischen Tochtergesellschaften mit 100 Prozent (bisher 60 Prozent) Eigenkapital unterlegen müssen. Laut Financial Times würde dadurch die Kernkapitalquote von 14 Prozent auf 19 Prozent ansteigen, was den Bedarf um 15 bis 25 Milliarden Dollar erhöhen würde. Daraufhin lancierte die UBS, was die NZZ als «grösste Lobbying-Aktion, die die Schweiz je erlebt hat» bezeichnet. «Mit allen Mitteln» versuche die UBS regulatorische Reformen zu verhindern, ihr Ton werde «schriller», «Halbwahrheiten, Druckversuche und Unterstellungen» würden die Debatte prägen.
Während Ermotti in einem offenen Brief Finanzministerin Keller-Sutter als «grösstes Hindernis» für eine erfolgreiche UBS bezeichnet und mit der Verlegung des UBS-Hauptsitzes ins Ausland droht, werden hinter den Kulissen die Fäden gezogen. Politik und Behörden würden aktiv bearbeitet, berichtet die NZZ, «Spin-Doctors» würden die internationale Presse mit Storys beliefern und dem SRF werde vorgeschrieben, wer in die Sendung «Eco Talk» eingeladen wird.
Weil die verschärfte Eigenkapitalvorschrift neuerdings nicht mehr in der bestehenden Eigenmittel-Verordnung, sondern im Bankengesetz verankert werden soll, verschiebt sich der Zeitplan zugunsten der UBS. Die Forderung muss den langwierigen parlamentarischen Prozess durchlaufen, womit die UBS einige Jahre für intensivierte Lobbyarbeit gewinnt.
Kapital hilft nicht gegen Panik
Das Gebaren der Bankiers, ihre weit ausgebauten Möglichkeiten zur Einflussnahme auf Politik und Öffentlichkeit sind mindestens bedenklich – die emotional aufgeladene Debatte ist in der Sache aber eine Scheindebatte: Ein dickeres Polster ist kein Sicherheitsnetz. Im Ernstfall zählt nicht die Eigenkapitalquote, sondern das Vertrauen.
Das hat der Fall der Credit Suisse, die bis kurz vor ihrem Kollaps gut kapitalisiert war, eindrücklich belegt. Vertrauensverlust reichte aus, um die Bank innerhalb kürzester Zeit zum Einsturz zu bringen. Wer so tut, als könne man dieses Risiko per Gesetz verbannen, verkauft politische Symbolik als Sicherheitsarchitektur.
